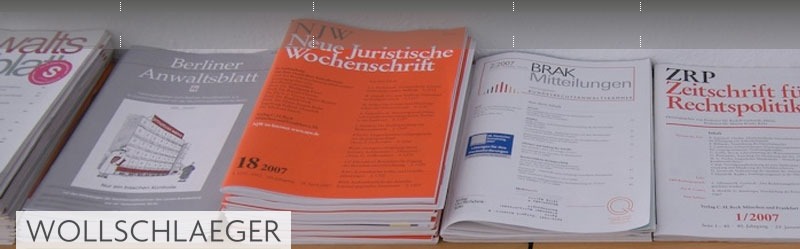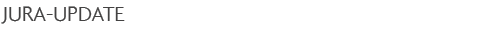Urteil vom 30. September 2025 – II ZR 154/23
Der unter anderem für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat den Beschluss der Hauptversammlung der Volkswagen AG über die Zustimmung zu einem Deckungsvergleich mit D&O-Versicherern im sog. “Dieselskandal” für nichtig erklärt. Soweit die Hauptversammlungsbeschlüsse über die Zustimmung zu Haftungsvergleichen mit ehemaligen Mitgliedern des Vorstands angefochten wurden, muss das Oberlandesgericht erneut verhandeln und entscheiden.
Sachverhalt:
Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie darauf bezogene Deckungsvergleiche mit D&O-Versicherern zur Abgeltung und Erledigung möglicher Schadensersatzansprüche und darauf beruhender Deckungsansprüche gegen die Versicherer. Sie war auf der Grundlage eines Untersuchungsberichts und weiterer Prüfungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sog. “Dieselskandal” fahrlässig verletzt hätten, weil sie Anhaltspunkte für den Einsatz unzulässiger Softwarefunktionen von Dieselmotoren nicht zum Anlass einer unverzüglichen Aufklärung genommen hätten. Die Vergleiche sahen als Eigenbeiträge bezeichnete Zahlungen der ehemaligen Vorstandsmitglieder in Höhe von 11,2 Mio. € bzw. 4,1 Mio. € und Zahlungen der D&O-Versicherer in Höhe von rund 270 Mio. € vor. Die Volkswagen AG verpflichtete sich ihrerseits, die beiden ehemaligen Vorstandsmitglieder von bestimmten Ansprüchen freizustellen, welche Dritte im Zusammenhang mit dem relevanten Sachverhalt gegen diese geltend machen könnten. In dem Deckungsvergleich verpflichtete sie sich zudem, näher bestimmte sonstige Personen, darunter sämtliche weitere ehemaligen oder amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, dauerhaft nicht mehr in Anspruch zu nehmen.
Die Hauptversammlung der Volkswagen AG stimmte den Vergleichsvereinbarungen am 22. Juli 2021 mit Mehrheiten von über 99% zu. Die Kläger sind Kapitalanlegerschutzvereinigungen. Sie erklärten als Aktionäre der Volkswagen AG gegen die Zustimmungsbeschlüsse Widerspruch zur Niederschrift.
Die Kläger wenden sich u.a. gegen die Zustimmungsbeschlüsse und meinen, diese seien nichtig, jedenfalls aber anfechtbar.
Bisheriger Prozessverlauf:
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die von den Klägern eingelegte Berufung hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Mit der vom Oberlandesgericht zugelassenen Revision haben die Kläger und ihr Streithelfer ihre Begehren in vollem Umfang weiterverfolgt.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Die Revision der Kläger hatte in wesentlichen Punkten Erfolg. Die Zustimmungsbeschlüsse sind allerdings nicht wegen eines Verstoßes gegen das Verbot der Rückgewähr von Einlagen (§ 57 Abs. 1 AktG) nichtig und die Beschlüsse verstoßen auch nicht gegen § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG, weil die dort bestimmte Sperrfrist von drei Jahren nicht eingehalten wurde.
Der Beschluss über die Zustimmung zum Deckungsvergleich ist aber wegen eines Gesetzesverstoßes anfechtbar und für nichtig zu erklären. In der Tagesordnung, die in der Einberufung zur Hauptversammlung angegeben war, wurde nicht den Anforderungen des § 121 Abs. 3 Satz 2 AktG entsprechend mitgeteilt, dass mit dem Deckungsvergleich ein Verzicht gegenüber sämtlichen amtierenden und ausgeschiedenen Organmitgliedern der Beklagten verbunden war, der nach § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG bzw. § 117 Abs. 4, § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG der Zustimmung der Hauptversammlung bedurfte. Die diesbezüglichen Angaben in dem Bericht des Vorstands genügen nicht, da sie nicht mehr Teil der in der Einberufung angegebenen Tagesordnung waren. Der durchschnittliche Aktionär musste nicht damit rechnen, dass die Informationen zu einer Beschlussfassung über einen Verzicht gegenüber einer Vielzahl weiterer Organmitglieder in den weiteren Informationen zu den betreffenden Tagesordnungspunkten enthalten waren.
Soweit das Oberlandesgericht die Anfechtbarkeit der den Haftungsvergleichen zustimmenden Beschlüsse gemäß § 243 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 AktG wegen einer Verletzung des Fragerechts nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVMG aF verneint hat, hielt dies einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Mit der gegebenen Begründung konnte nicht angenommen werden, dass die verlangte Auskunft zu den Vermögensverhältnissen der ehemaligen Mitglieder des Vorstands für die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Entscheidung über die Zustimmung zu den Haftungsvergleichen nicht wesentlich war. Der Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands gibt als wesentlichen Grund für den Abschluss der Vergleichsvereinbarungen unter anderem an, die finanzielle Leistungsfähigkeit der in Anspruch genommenen Personen erreiche auch unter Berücksichtigung der Versicherungssumme bei weitem nicht die diesen Personen aus Sicht der Gesellschaft zurechenbaren Schäden. Auskünfte zur Vermögenslage der in Anspruch genommenen ehemaligen Mitglieder des Vorstands waren zumindest insoweit für eine informierte Entscheidung über die Zustimmung erforderlich, als es darum ging, diese Beurteilung nachzuvollziehen. Die erteilten Auskünfte insbesondere zu den bezogenen Einkommen genügen hierfür nicht, weil sich aus diesen Angaben nicht erschließt, in welchem Umfang etwaige Haftungsansprüche durch eigenes Vermögen der ehemaligen Vorstandsmitglieder gedeckt gewesen wären. Der Bundesgerichtshof konnte auf der Grundlage der Feststellungen nicht zuverlässig ableiten, ob die im Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats wiedergegebene Annahme unter Berücksichtigung der in der Hauptversammlung erteilten Auskünfte hinreichend erläutert wurde.
Vorinstanzen:
Landgericht Hannover – Urteil vom 12. Oktober 2022 – 23 O 63/21
Oberlandesgericht Celle – Urteil vom 29. November 2023 – 9 U 93/22
Die maßgeblichen Vorschriften lauten:
Aktiengesetz (AktG)
§ 243 Anfechtungsgründe
(1) Ein Beschluß der Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung durch Klage angefochten werden.
(2) (…)
(3) (…)
(4) Wegen unrichtiger, unvollständiger oder verweigerter Erteilung von Informationen kann nur angefochten werden, wenn ein objektiv urteilender Aktionär die Erteilung der Information als wesentliche Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung seiner Teilnahme- und Mitgliedschaftsrechte angesehen hätte. (…)
§ 93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. (…)
(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. (…)
(…)
(4) (…) Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich über sie vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. (…)
(…)
§ 57 Keine Rückgewähr, keine Verzinsung der Einlagen
(1) Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt werden. (…)
(…)
§ 121 Allgemeines
(1) (…)
(2) (…)
(3) Die Einberufung muss die Firma, den Sitz der Gesellschaft sowie Zeit und Ort der Hauptversammlung enthalten. Zudem ist die Tagesordnung anzugeben. (…)
(…)
Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (COVMG aF)
§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
(1) (…)
(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern
1. (…)
2. (…)
3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt wird,
4. (…)
(…)
Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. (…)
Karlsruhe, den 30. September 2025
Pressestelle des Bundesgerichtshofs
76125 Karlsruhe
Telefon (0721) 159-5013
Telefax (0721) 159-5501
Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofes Nr. 177/2025 vom 30.09.2025